Lasttragender und nicht lasttragender Strohballenbau
Lasttragender und nicht lasttragender Strohballenbau
LASTTRAGENDER UND NICHT LASTTRAGENDER STROHBALLENBAU
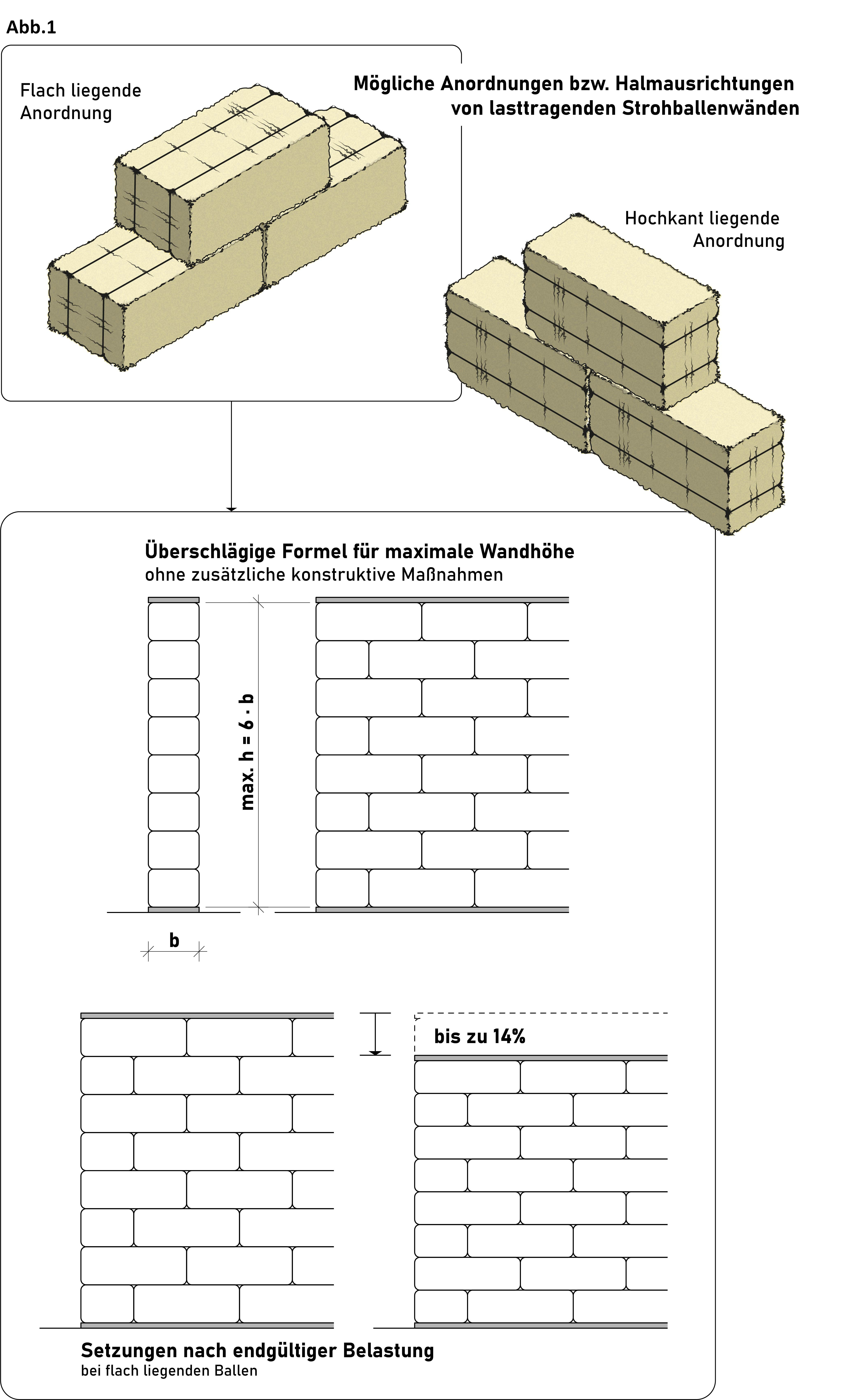
LASTTRAGENDE STROHBALLENBAUWEISE
Das lasttragende Bauen aus Strohballen ist vom Prinzip her relativ einfach. Dennoch wird die Bauweise vor allem hierzulande selten angewandt. Da die Strohbaurichtlinie sich nur auf die nicht lasttragende Bauweise bezieht, gibt es für das lasttragende Bauen bisher keine allgemein anerkannten Regeln. Deswegen ist für die Baugenehmigung eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) erforderlich, was meist mit einem nicht unerheblichen finanziellen bzw. planerischen Aufwand verbunden ist und das Umsetzen somit aus wirtschaftlichen Gründen vor allem für private Bauherr:innen erschwert wird. Eingeschossige Bauten sind jedoch mit landwirtschaftlich üblichen Kleinballen realisierbar, wohingegen mehrgeschossige Bauten ausschließlich mit Großballen umgesetzt werden sollten. [1] Unabhängig der Ballengröße sollte die Dichte der Ballen im Mindesten 110kg/m³ betragen. [2] Somit ist die Dichte bei der lasttragenden Bauweise höher zu wählen als bei der nicht lasttragenden Bauweise.
Da Strohballen im Vergleich zu konventionellen Bauweisen sich stark stauchen lassen, ist konstruktiv einiges zu beachten. Wie hoch Wände gebaut werden können, ist abhängig von der Halmausrichtung der Ballen. Diese sollten entweder flach liegend oder hochkant liegend eingebaut werden. Für die Wandhöhe gilt folgende überschlägige Formel:
Max. h = b x 6
Bei klassischen Maßen von Kleinballen von 48 x 36cm ergibt sich daraus folgende maximale Wandhöhe:
Hochkant liegende Ballen: max. h = 0,36m x 6 = 2,16m
Flach liegende Ballen: max. h = 0,48m x 6 = 2,88m
Zusätzlich müssen noch Setzungen in der Konstruktion berücksichtigt werden, die überschlägig bei nicht vorkomprimierten Wänden etwa mit 14% bei flach liegenden und mit etwa 10% bei hochkant liegenden Ballen angenommen werden können. D.h. effektiv bleiben nach den Setzungen bei der hochkant liegenden Variante ca. 1,94m und bei der flach liegenden ca. 2,48m Wandhöhe übrig. Da übliche Raumhöhen heutzutage 2,50m betragen, müsste bei der hochkant liegenden Bauweise demnach zusätzlich ein Sockel eingeplant werden, auf dem die Wand dann gestellt werden kann.
Möchte man dennoch höher bauen, hat man zum einen die Möglichkeit in die Ballenlagen zusätzliche Aussteifungselemente (wie Ringbalken) einzulegen oder Großballen einzusetzen. Großballen führen zwar zu deutlich dickeren Wänden, dafür sind sie aber stärker vorkomprimiert und Setzungen fallen geringer aus. Aus statischer Sicht sind Großballen daher, auch unter dem Aspekt, dass sie mehr Auflagefläche bieten, Kleinballen vorzuziehen. Was die Steifigkeit angeht, gelten folgende Regeln:
· Hochkant liegende Ballen sind steifer als flach liegende Ballen
· Großballen sind steifer als Kleinballen
· Ganz Wandelemente sind steifer als einzelne Kleinballen, da sie sich in der Querausdehnung gegenseitig behindern.
Zu beachten ist grundsätzlich, dass eine lasttragende Ballenkonstruktion nur dann statisch wirksam ist, wenn sie gegen Ausbeulen gesichert ist. Das wird dadurch gewährleistet, dass die Konstruktion sowohl am Fuß als auch am oberen Abschluss der Wand in Position gehalten werden. Am oberen Ende geschieht dies durch Ringbalken, die zusätzlich die Lasten aus Decken und Dach aufnehmen und diese gleichmäßig in die Wand einleiten. Am Fußpunkt kann ebenfalls ein Ringbalken eingesetzt werden oder eine entsprechende Befestigung an der Boden- bzw. Deckenplatte erfolgen (wichtig ist, dass auch hier die Ballen in Position gehalten werden und nicht nur lose aufliegen). Das obere und untere Ende wird durch Spanngurte vorgespannt und die Ballen verdichtet, bevor Decke oder Dach oben aufgelegt werden. Innerhalb der Wand kommen zusätzlich Ballennägel oder Gewindestangen zum Einsatz, die für zusätzliche Stabilität sorgen. [3]
Um den prinzipiellen Ablauf bei der lasttragenden Bauweise anschaulich nachvollziehen zu können, sieh dir das Kapitel >>> Demonstrator: Lasttragend aus Strohballen bauen <<< an.
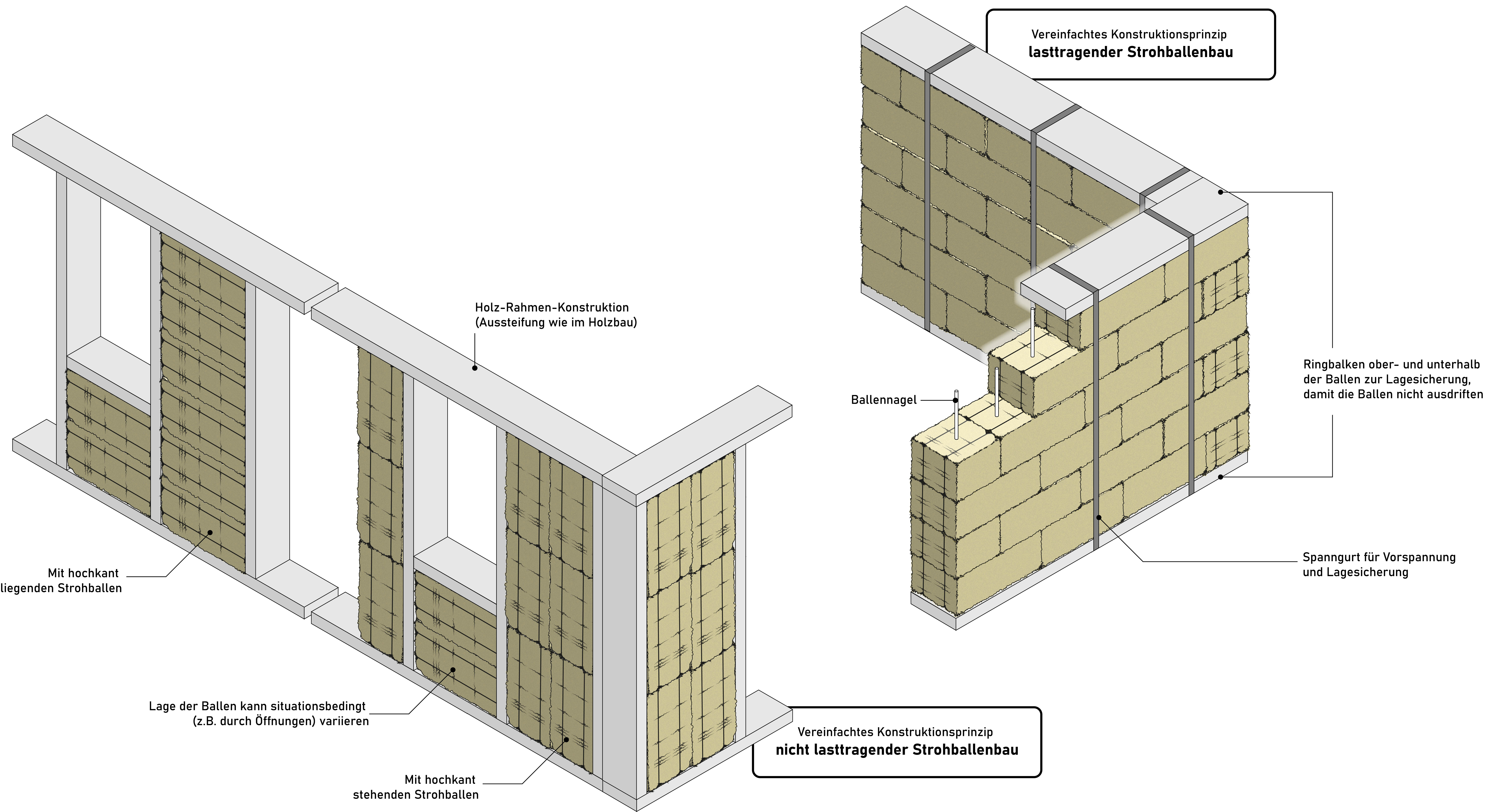
Abb.2: Prinzipielle Darstellung einer nicht lasttragenden (links) und einer lasttragenden Strohballenbauweise (rechts)
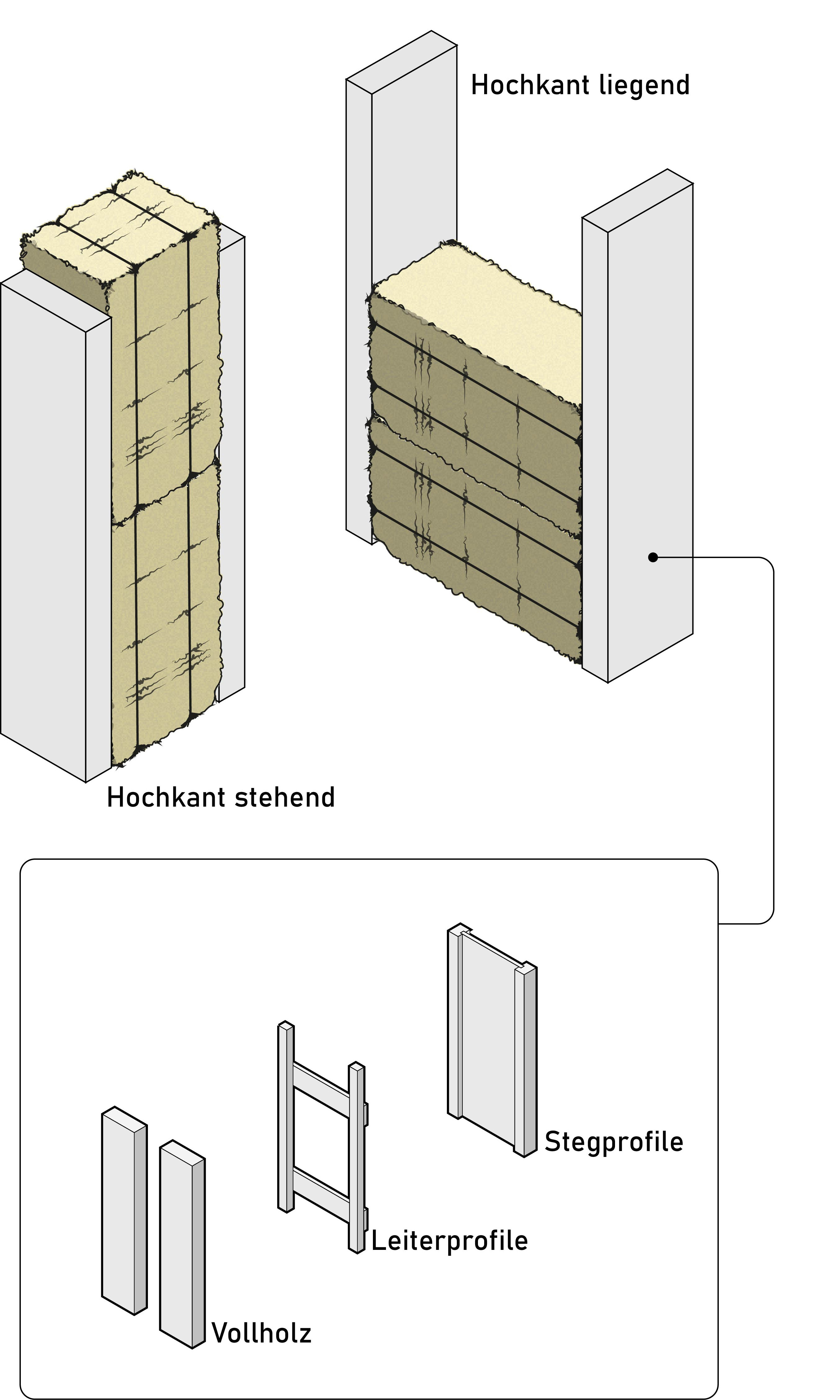
NICHT LASTTRAGENDE STROHBALLENBAUWEISE
Während die lasttragende Bauweise in Deutschland noch eine Seltenheit ist, ist die nicht lasttragende Strohballenbauweise schon bekannter und aus genehmigungstechnischer Sicht auch mit geringerem Aufwand umsetzbar. Grund dafür ist in erster Linie, dass das lasttragende Gerüst einer klassischen Holz-Rahmen-Konstruktion gleichkommt. Klassischerweise werden für die Holzständer Vollholz, Leiter- oder Stegprofile verwendet. Während die Holzkonstruktion also sämtliche auftretenden vertikalen und horizontalen Lasten aufnimmt, fällt den Strohballen als Gefache in erster Linie die Aufgabe der Dämmung zu. Im Kapitel >>> Strohballenbau allgemein <<< wurde bereits darauf hingewiesen, dass Strohballen die beste Dämmwirkung erzielen, wenn sie hochkant stehend oder hochkant liegend eingebaut werden. Beides lässt sich in der nicht lasttragenden Bauweise umsetzen. Die Halmausrichtungen können innerhalb der gleichen Konstruktion auch variieren, was häufig aufgrund von Öffnungsmaßen der Fall sein kann. Jedoch sollte in der Planungsphase von Anfang an das Ballenformat der später einzubauenden Ballen bekannt sein, damit das Raster des Holzständerwerks entsprechend eingeplant werden kann. Das übliche Holzbauraster von 62,5cm wird im nicht lasttragenden Fall zu Gunsten der später einfacher handzuhabenden Balleneinbringung aufgegeben und stellt den wohl einzig relevanten Unterschied zu herkömmlichen Holz-Rahmen-Bauten dar (bei Holz-Rahmen-Bauten im klassischen Raster kann trotzdem mit Stroh gedämmt werden, hierfür wäre dann aber eine Stroh-Einblasdämmung die effizientere Wahl). Die Strohballenebene kann selbstverständlich auch außenseitig vor der tragenden Konstruktionsebene liegen. So lässt sich die nicht lasttragende Bauweise auch mit Holzmassiv-Konstruktionen (bspw. Brettschicht- oder Brettsperrholz) umsetzen. Außerdem ist eine vorgesetzte Dämmebene aus Strohballen in der Altbausanierung eine beliebte Variante, um bestehende Wände ökologisch sinnvoll zu optimieren. Bei von Holz abweichenden Konstruktionen kann das Risiko auf Wärmebrücken und daraus resultierenden Bauschäden erhöht werden. Planerisch ist bei egal welcher Art der Ausführung lediglich zu berücksichtigen, dass die Ballen in ihrer Lage gesichert sind. Das kann durch Plattenverkleidungen, Rispenbänder, Putzsystemen uvm. geschehen. [4]
Zu den anderen Kapiteln über Strohbau:
>>> Strohballenbau allgemein <<<
>>> Demonstrator: Lasttragend aus Strohballen bauen <<<
>>> ZURÜCK ZUR KAPITELÜBERSICHT <<<
Quellen
[1] Fachverband Strohballenbau Deutschland e.V. – FASBA: Die Bauweisen des Strohballenbaus. <https://fasba.de/bauen-mit-stroh/bauweisen/>; Aufruf: 09.12.2024
[2] Minke, Gernot; Krick, Benjamin (2004): Handbuch Strohballenbau – Grundlagen, Konstruktionen, Beispiele. Staufen bei Freiburg, ökobuch Verlag, S.47
[3] Wie [2] S.31, 38, 47
[4] Wie [2] S.37f
Abbildungen
Abb.1: Lasttragender Ballenbau: Halmausrichtung, Maximale Wandhöhe und Setzungen
Grafik von Lennard Thier nach [2] S.46, 47
Abb.2: Prinzipielle Darstellung einer nicht lasttragenden (links) und einer lasttragenden Strohballenbauweise (rechts)
Grafik von Lennard Thier
Abb.3: Halmausrichtung und Ständerprofile bei nicht lasttragender Bauweise
Grafik von Lennard Thier nach [2] S.52