Kreislaufgerechtes Bauen
Kreislaufgerechtes Bauen
KREISLAUFGERECHTES BAUEN
Autor:innen des Beitrags: Mensur Nasufi & Tobias Walliser
Das weltweite Bevölkerungswachstum hat zu einem steigenden Ressourcenbedarf geführt, insbesondere im Bausektor. In Deutschland verursacht dieser jährlich etwa 414 Millionen Tonnen Abfall. Ein nachhaltiger Umgang mit Baustoffen kann nicht nur die CO₂-Emissionen senken, sondern auch durch die Wiederverwendung von Bauteilen zur Abfallreduktion und zur Schonung knapper Ressourcen beitragen. Derzeit decken Recyclingbaustoffe lediglich 13 % der gesamten Nachfrage. [1] Einmal auf einer Deponie entsorgt, werden Bauabfälle in der Regel nicht mehr genutzt. Die frühzeitige Berücksichtigung dieser Problematik in der Planungs- und Entwurfsphase kann wesentlich zur Reduktion von Bauabfällen beitragen.
Die heutigen Bestandsgebäude haben das Potenzial verloren als direkte Materialquelle zu dienen. Seit Mitte der 20. Jahrhunderts hat sich die Industrie darauf konzentriert Produkte auf den Markt zu bringen, die eine immer höhere Qualität, bessere und schnellere Verarbeitung und günstigere Beschaffung innehaben. Viele solcher Baumaterialen werden als Komposite oder Verbandmaterialien hergestellt, die mit untrennbaren Stoffen nicht rein zurückgewonnen werden können. Zusätzlich sind sie mit synthetischem Kleber, Schäumen, Beschichtungen und Lackierungen behandelt, was es unmöglich macht sie erneut zu gebrauchen und schlussendlich auf der Deponie landen. Bei diesem linearen System wurde die Frage, was mit dem Materialen nach der Nutzungsphase geschehen soll, nicht gestellt. [2]
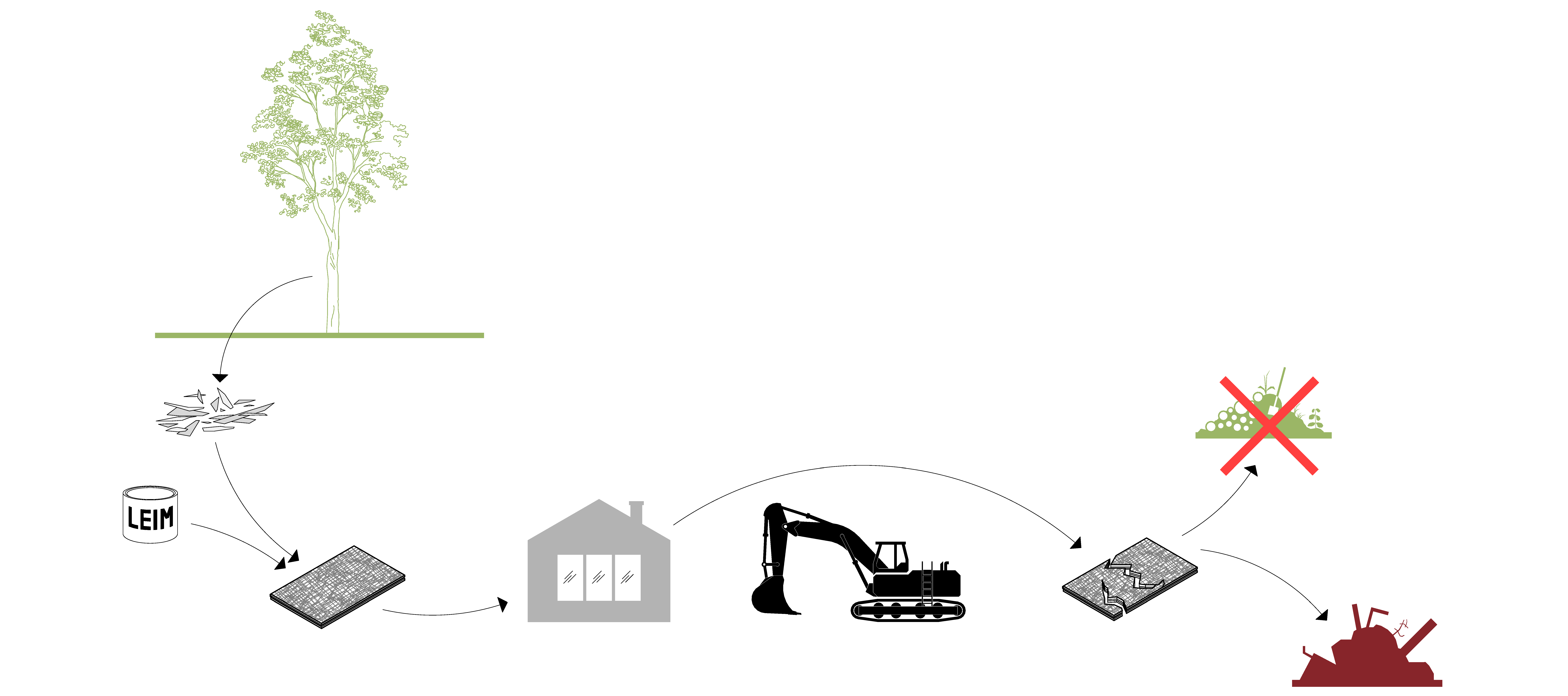
Abb.1: Beispielhafte Darstellung einer linearen Ressourcenverwendung
Ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen im Bauwesen ist jedoch nur ein erster Schritt. Für eine umfassende Abfallreduktion und Ressourcenschonung bedarf es eines weitergehenden Ansatzes: der Kreislaufgerechtigkeit. Sie geht über die herkömmlichen Recyclingansätze hinaus, indem es die Planung, den Bau, die Nutzung und den Rückbau eines Gebäudes von Anfang an ressourceneffizient und umweltgerecht gestaltet. Eine ressourcenschonende Alternative zum Neubau ist die Arbeit mit einer bestehenden Struktur, vor allem in der Rohbauphase, da diese schon besteht. Gebäude sollten so lange wie möglich erhalten werden, durch Sanierung, Modernisierung, Renovierung oder durch Nutzungsänderungen. Durch eine energetische Optimierung können Altbauten energieeffizient betrieben werden.
Bei der Kreislaufgerechtigkeit unterscheidet man bei der erneuten Verwendung von Materialien in drei Kategorien: Die Wiederverwendung, die Wiederverwertung und die Weiterverwertung:
- Die Wiederverwendung von rückgebauten Baumaterialien stellt ressourcenbasiert und energetisch die effizienteste Lösung der Kreislaufführung dar. Ein Bauteil wird nach seinem ursprünglichen Einsatz an einer anderen Stelle als Ganzes erneut verbaut. Diese Bauteile müssen funktionsfähig sein und sollten technisch für den neuen Einsatzzweck geeignet sein. Bereits bei der Planung könnten Bauteile mit einem Rückbaukonzept hergestellt werden, um die Wiederverwendung zu erleichtern. Die Trennung der Materialien sollte vereinfacht sein und möglichst wenig mit Verklebungen gearbeitet werden. [3]
Ein großes Potenzial bieten bspw. Spannbetonelemente, die eine höhere Druckfestigkeit aufweisen und einfacher zu demontieren sind. Für die Wiederverwendung müssen die Normen über die Standsicherheit und Tragfähigkeit einbehaltet werden. [4] - Daneben gibt es die Wiederverwertung von Bauteilen, also das weitere Nutzen der Stoffe, aus denen ein bestimmtes Bauteil besteht. Hierbei verbleibt das Bauteil nicht in seiner ursprünglichen Form, sondern wird beispielsweise in einzelne Stoffe zertrennt oder zermahlen. Dieser Prozess des Recyclings und der Herstellung der neuen Bauteile benötigt jedoch einen höheren Energieaufwand als eine direkte Wiederverwendung der Materialien. [3]
- Eine dritte Variante ist die Weiterverwertung. Es beschreibt die Nutzung von Materialien oder Produkten, die zwar nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form verwendet werden können, aber durch zusätzliche Verarbeitungsschritte wieder in den Wertstoffkreislauf eingebracht werden. Dies kann beispielsweise die Umwandlung von Abfällen in Energie oder die Nutzung von recycelten Materialien zur Herstellung neuer Produkte umfassen. [5]
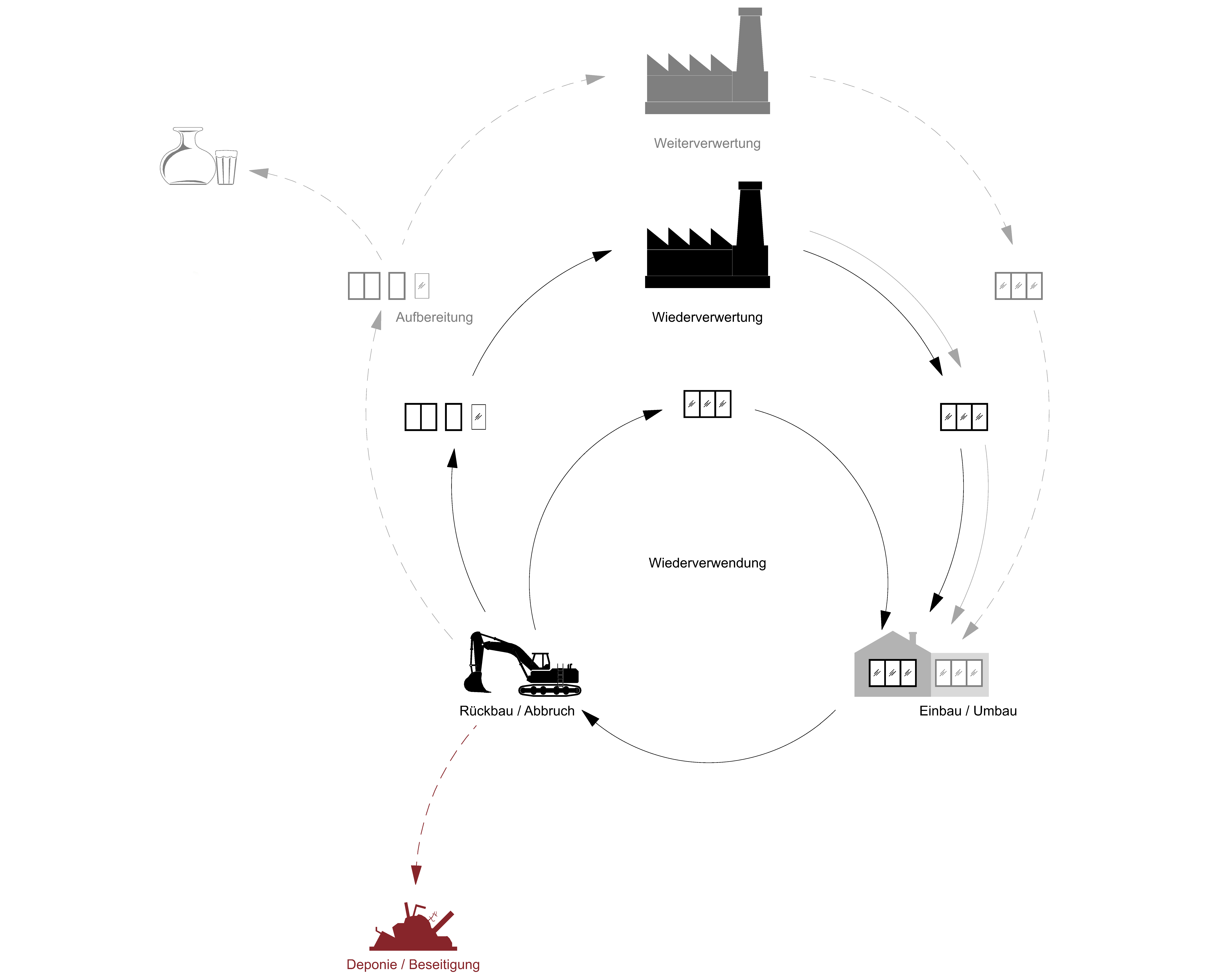
Abb.2: Kreislaufdiagramm
>>> ZURÜCK ZUR KAPITELÜBERSICHT <<<
Quellen
[1] Kraus, Petra (2024): "Energieverbrauch und Klimaschutz im Baugewerbe – eine Datensammlung", in: Bauindustrie. Berlin: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.
[2] Hebel, Dirk; Heisel, Felix (2022): Kreislaufgerechtes Bauen und Kreislaufwirtschaft. Basel: Birkhäuser.
[3] Lambrecht, Astrid (2024): Wiederverwertung. <https://www.enargus.de/pub/bscw.cgi/d13861-2/*/*/Wiederverwertung?op=Wiki.getwiki&search=Wiederaufbereitung>;; Aufruf: 27.11.2024
[4] Hermann, Sascha (2024): Wiederverwendung von Bauprodukten. <https://www.ressource-deutschland.de/baumaterialien/wiederverwendung-von-bauprodukten>; Aufruf: 27.11.2024
[5] Gebhardt, Klaus (2013): Das Umwelt-Lexikon Weiterverwertung. <https://www.umweltdatenbank.de/cms/lexikon/49-lexikon-w/2279-weiterverwertung.html>;; Aufruf: 27.11.2024
Abbildungen
Abb.1 Eigene Grafik von Mensur Nasufi und Tobias Walliser
Abb.2 Eigene Grafik von Mensur Nasufi und Tobias Walliser nach: Hillebrandt, Annette; Riegler-Floors, Petra; Rosen, Anja; Seggewies, Johanna-Katharina (2018): Atlas Recycling. Edition Detail. München. S.59
Der Beitrag wurde redaktionell von Lennard Thier überarbeitet.